“Allen grünalternativen Frauen in Funktionen, sei es als Bezirksrätinnen, sei es parteiintern, sei eines aus eigener Erfahrung empfohlen: Mund aufmachen, keine Ängste und brüllt sie ruhig an, auch wenn eine andere Kultur angebracht wäre”, schreibt Hedvig-Doris “Hedi” Spanner-Tomsits in ihrer Rückschau auf drei Jahre als grüne Bezirksrätin in Wien-Josefstadt, erschienen in der Zeitschrift “Brot & Rosen” 4/1992.
Download im Original-Layout: 219-brot-rosen-bezirksraetin-mund-aufmachen (PDF, 0,3 MB)
Grüß Sie Gott, Frau Bezirksrat eh -Rätin!
Gremien, ob offizielle oder private, entpuppen sich in der Regel nach kürzester Zeit als Tummelplätze der Selbstdarstellung, insbesondere männlicher Selbstdarstellung. Oftmals erinnern sie in ihrem Habitus an die Urzeiten der Menschheit oder besser ausgedrückt an die evolutionäre untere Ebene, nämlich der Menschenaffen.
oberlehrerhaft
Natürlich hierarchisch gegliedert, erlebt man die Auftritte der sogenannten offiziellen bzw. inoffiziellen Führer, je nach Gruppenstruktur. Von belehrendem Verhalten gegenüber der eigenen Fraktion als auch gegenüber der Gegnerkollegenschaft: “Schauen’s, Frau Kollegin, des müssens so machen” bis über’s oberlehrerhafte Abprüfen der Geschäftsordnung: “Des müssens eigentlich schon wissen!”. Die Oberliga der Bezirksführerschaft ist, was natürlich durchaus als politisch-strategisches Denken aufgefaßt werden kann, nicht besonders auskunftsfreudig, allerdings auch dort, wo’s längst überflüssig ist. In mittlerweile altbekannte Angelegenheiten wird endlos hineingeheimst, sodaß es an Magierituale der Medizinmänner von Naturvölkern erinnert.
Durchschaut man mit der Zeit diese Strukturen, erlebt man, daß die Informationsbeschaffung hauptsächlich vom Bezirksvorsteher erfolgt. D.h. in der Praxis weiß der Bezirksvorsteher plus Vertreter soviel wie die kleinen Oppositionsparteien. Ob es an eigener Unfähigkeit liegt oder an tatsächlich behaupteter Uninformiertheit seitens der eigenen Partei, möge dahingestellt sein. Allerdings ist ersichtlich, und wird so im privaten Rahmen gerne bestätigt, daß die eigenen Bezirksgranden seitens des Rathauses nicht sonderlich ernstgenommen werden. Abänderungsvorschläge der Bezirksstrukturen werden aber empört abgewiesen, hätten sie doch zumindest die eigene Existenz betreffend, äußerst nachteilige Konsequenzen für die Bezirkshäuptlinge. Weiterlesen
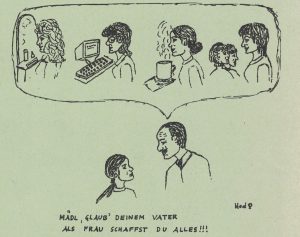
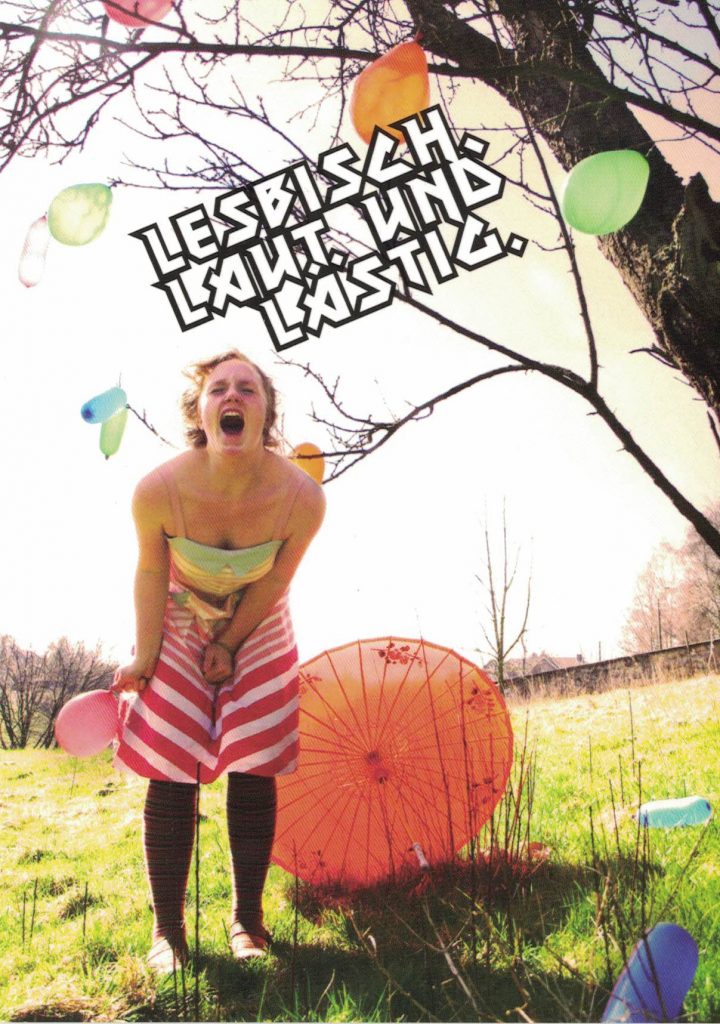
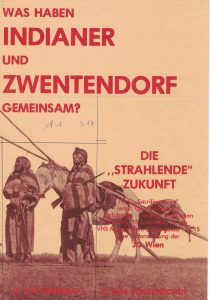
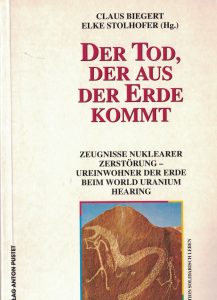
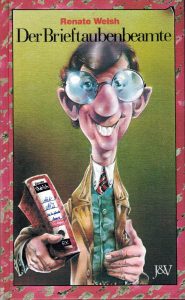

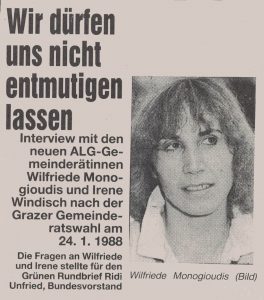
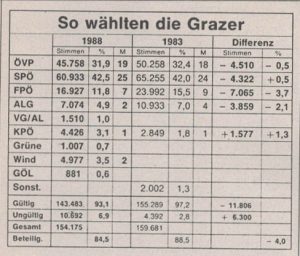




Neueste Kommentare