Blick zurück ins Jahr 1993: Der damalige grüne Bezirksrat und EDV-Unternehmer Ronald Schmutzer und Karl Öllinger, Sekretär der “Gewerkschaftlichen Einheit”, im Disput über grüne Sozialpolitik, Wirtschaftswachstum, Grundeinkommen und Lohnnebenkosten. Das Gespräch wurde von Gudrun Hauer für die Zeitschrift “Impuls grün” geführt.
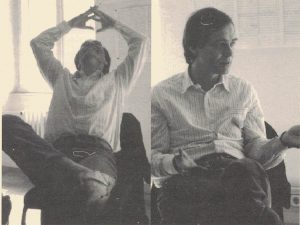
Ronald Schmutzer. FotografIn: unbekannt.
Impuls: Von den Grünen gibt es wenige Aussagen zur Sozialpolitik. Sie fehlen zur Stillegung der Papierfabrik Hallein, zum Konkurs der Assmann-Betriebe, zur Krise in der Verstaatlichten Industrie, zur zunehmenden Arbeitslosigkeit.
Schmutzer: Das ist eine traditionelle Schwäche der Grünen. Der Zugang zur Grünen Bewegung kam aus zwei Richtungen: Die eine ist die Ökologiebewegung, die traditionell wenig mit sozialen Themen zu tun hatte; der zweite Zugang ist die Kapitalismuskritik. Beide sind zusammengewachsen zur Grünen Alternative. Das ergibt schwarze Löcher. Heute versucht man fehlende Teile aufzuarbeiten. Darüberhinaus scheißt man sich ein bißchen an, weil das Nein zum Wirtschaftswachstum der Öffentlichkeit schwer zu vermitteln ist. Das ist einer der Gründe, warum uns wenige wählen, weil die Leute das Gefühl haben, die kosten uns nur Geld.
Öllinger: Ich gebe Dir soweit Recht, als es eine traditionelle Schwäche war, und ergänze es insofern, als es heute keine Schwäche mehr sein darf. Keine Aussagen zur Sozialpolitik zu machen heißt, einverstanden zu sein mit dem, was da geschieht. Aber ich kenne die Grünen so gut, nachdem ich auch einer bin, daß sie nicht damit einverstanden sind. Aber sie neigen einem Verständnis von Sozialpolitik zu, das als Armenpolitik beschrieben werden kann. Sozialpolitik ist aber umfassender als Wirtschaftspolitik, weil sie den Anspruch beinhaltet, Gesellschaft zu gestalten. So gesehen haben die Grünen eine große Aufgabe vor sich. In der aktuellen Situation stört mich besonders, daß die seltenen Aussagen zur Sozialpolitik sehr gedankenlos sind. Bei der Enquete zur Arbeitsmarktpolitik im Herbst ist sehr viel an konkreten Forderungen erarbeitet worden, aber mit den Ergebnissen wird nicht Politik gemacht. Stattdessen werden Aussagen gemacht, die Senkung der Lohnnebenkosten sei ein grünes Ziel. Aktuell heißt das: keine Abfertigungen, die Debatte um das 13. und 14. Gehalt aufnehmen, in der Sozialversicherung Abstriche hinnehmen.
Schmutzer: Das ist ein Mißverständnis, Karl! Es hat niemand gesagt, die Lohnnebenkosten sollten im Sinn von Sozialabbau gesenkt werden. Gemeint ist eine Steuerreform, die die Grünen anstreben. Arbeit sollte weniger, Raub der Ressourcen, Energieverbrauch – sollte stärker belastet werden. Eine Senkung der Lohnnebenkosten allein war nie das Ziel.
Öllinger: Auch ich bin der Meinung, Energie muß besteuert werden. Die Grünen können sich aber nicht vor der Aussage drücken, wie sie zur Besteuerung des Kapitals stehen. Diese Frage spielt keine Rolle mehr. Wir sind in der perversen Situation, daß mit vorhandenem Kapital im industriellen und Dienstleistungsbereich wenig Investitionen und viel Spekulation stattfindet, weil da wesentlich mehr Geld zu holen ist.
Es ist schwer, in Österreich ein reales Geschäft zu machen. Es ist leichter zu spekulieren, etwa mit Wohnungen, als in einem realen Geschäft mit Angestellten.
Schmutzer: Es ist aber mit der Argumentation nicht getan, daß man den Arbeitsmarkt fördert, wenn man das Kapital bestraft. Es ist schwer, in Österreich ein reales Geschäft zu machen. Es ist leichter zu spekulieren, etwa mit Wohnungen, als in einem realen Geschäft mit Angestellten.
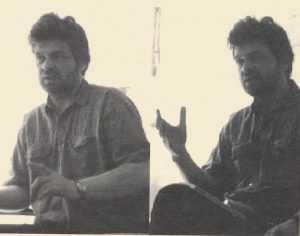
Karl Öllinger. FotografIn: unbekannt.
Öllinger: Das mag eine Frage der Reglementierung, der Gewerbeordnung sein. In anderen Ländern gibt es aber dieselben Phänomene.
Schmutzer: Wir tun immer so, als ob man einzig mit Arbeit seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Wir müssen aber auch darüber reden, ob es nicht ein menschenwürdiges, arbeitsloses Einkommen geben sollte. Damit meine ich ein Grundeinkommen.
Öllinger: Ich bin Dir dankbar dafür, daß das Thema in die Debatte eingeführt wird, weil ich in der Realität dazu neige, es wegzuschieben. Denn angesichts der aktuellen sozialen Situation sehe ich ein Grundeinkommen nur in der Höhe kommen, wo es nicht menschenwürdig ist. Der soziale Druck führt dann dazu, daß das arbeitslose Einkommen dazu verwendet wird, doch wieder zu arbeiten.
Schmutzer: Um die letzte Hacken zu machen! Von den Menschen könnte ein Druck weggenommen werden. Wer außer uns sollte darüber reden? Weiterlesen
 In der GAZ, der Grün-Alternativen Zeitung für Wien, vom Jänner 1992 wurden den damaligen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten Wiens folgende persönliche Fragen gestellt:
In der GAZ, der Grün-Alternativen Zeitung für Wien, vom Jänner 1992 wurden den damaligen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten Wiens folgende persönliche Fragen gestellt: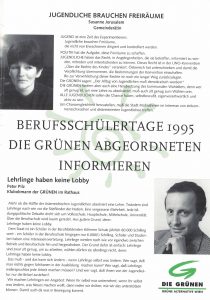
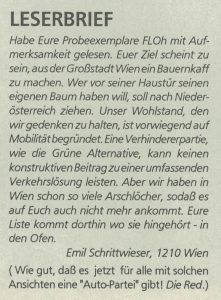

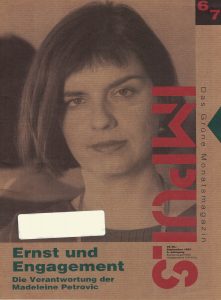


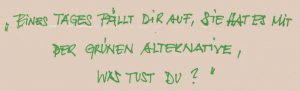
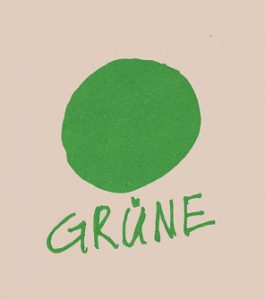
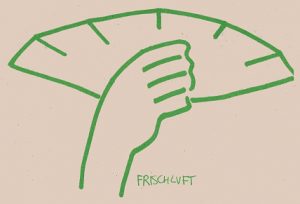
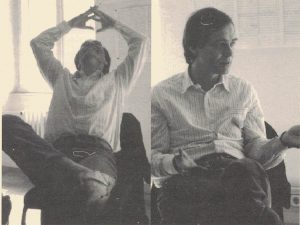
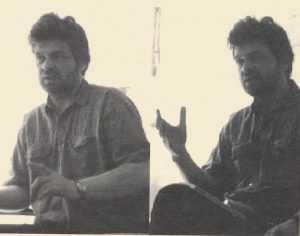

Neueste Kommentare