“Die demokratische Revolution desJahres 1989 hat in den Ländern Ost- und Ostmitteleuropas nicht nur zum Zerfall des Stalinismus, sondern auch zu neuen Herausforderungen geführt: wachsende soziale Probleme, Nationalismus, zerstörte Umwelt… Diesen Herausforderungen stellt sich eine Fülle neuer Gruppen und Parteien, darunter auch Grüne”. Gerhard Jordan stellte in der Zeitschrift “Impuls grün” 4/1990 die grünen Parteien vor, die nach bzw. im Zuge der “Wende” gegründet worden waren. Titel seines Beitrags: “Die Grünen werden gesamteuropäisch”. Download im Originalformat: 157-impulsgruen-gruene-mittel-osteuropa (PDF, 1 MB)
// DDR: Am 24.11.89 wurde die “Grüne Partei in der DDR” von AktivistInnen aus oppositionellen Umwelt- und Friedensgruppen, die sich in den 80er-Jahren im Umfeld der Evangelischen Kirche gebildet hatten, gegründet. Beim Parteitag vom 9.-11.Feb.1990 in Halle wurde das Programm (das inhaltlich denen westeuropäischer grünalternativer Parteien ähnelt) beschlossen. Bei der Volkskammerwahl am 18.3. erhielten die mit dem “Unabhängigen Frauenverband” verbündeten Grünen 1,97% und 8 der 400 Sitze und blieben, wie schon zu Zeiten des Honecker-Regimes, Opposition.
Kampf gegen das Donaukraftwerk Nagymaros
Ungarn: Die ”Grüne Partei Ungarns” (“Magyarországi Zöld Párt“, MZP) entstand vor allem aus der Bewegung gegen das Donaukraftwerk Nagymaros. Ihr Gründungskongreß fand am 18./19.11.89 in Budapest statt. Aufgrund des “hürdenreichen” Wahlrechts gelang der jungen Partei die Aufstellung von Listen nur in 4 der 19 (mit Budapest 20) Komitate. Bei den Wahlen am 25.3. kam sie auf einen landesweiten Durchschnitt von 0,4%. Weiterlesen






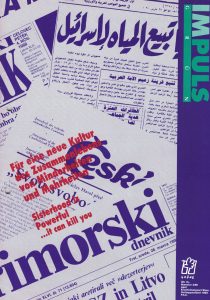

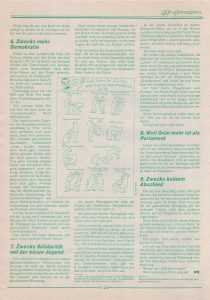
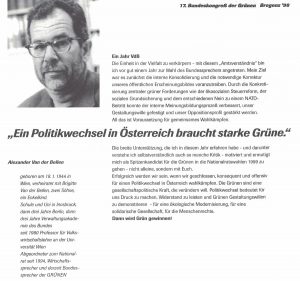

Neueste Kommentare