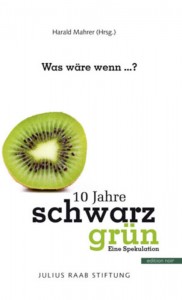
Harald Mahrer (Hg.) / Julius Raab Stiftung: Was wäre wenn…? 10 Jahre Schwarz-Grün. Eine Spekulation. Wien: Verlag noir 2013
Heute vor dreizehn Jahren, am 16. Februar 2003, nahm der Erweiterte Bundesvorstand – nach dem Bundeskongress das zweithöchste Gremium der Grünen – das Nicht-Zustandekommen einer “schwarz-grünen” Koalition zur Kenntnis. Die ÖVP war den Grünen in entscheidenden Fragen nicht entgegen gekommen. Zu den Knackpunkten zählten ein faires Pensionsmodell, der Einstieg in die Grundsicherung, der Verzicht auf Studiengebühren und Abfangjäger, der Vorrang der Schieneninfrastruktur vor der Straße und andere.
Am 28. Februar 2003 wurde eine neuerliche ÖVP-FPÖ-Regierung unter Bundeskanzler Wolfgang Schüssel angelobt.
Harald Mahrer hat 2013 für die Julius Raab_Stiftung das Buch “Was wäre wenn …? 10 Jahre Schwarz-Grün. Eine Spekulation” herausgegeben, in dem Politiker_innen der ÖVP und der Grünen sowie Journalist_innen überlegen, wie Österreich aussehen würde, wenn diese Koalitionsverhandlungen nicht gescheitert wären. Das Buch kann gedruckt im Grünen Archiv oder online (PDF, 500 KB) nachgelesen werden. Aus dem Abstract: “Ein schwarz-grünes Projekt unter dem Dach der Grundwerte der Ökosozialen Marktwirtschaft könnte einen wichtigen Impuls liefern, um die Ökosoziale Marktwirtschaft konsequent umzusetzen. Sie bringt nicht nur Wohlstand, sondern auch Zukunft für alle”.
“Ich war vor 10 Jahren nicht Abgeordneter, sondern Landessprecher der Wiener Grünen. Dort haben wir die Verhandlungen zunächst sehr kritisch verfolgt, dann offen rebelliert. Falsch sind aber alle Legenden, die behaupten, dass die Verhandlungen an den Wiener Grünen gescheitert wären. Tatsächlich gab es eine viel breitere Skepsis innerhalb der Grünen – die Wiener Grünen waren nur die ersten, die das auch öffentlich thematisiert haben. Letztendlich haben aber die grünen VerhandlerInnen um Alexander van der Bellen nach einer langen Verhandlungsnacht die Gespräche selbst abgebrochen, weil sie keine Chance auf Einigung gesehen haben. Dieser Verhandlungsabbruch war richtig und auch ich würde wieder unter ähnlichen inhaltlichen Rahmenbedingungen wie damals zu den Kritikern einer Koalition gehören”, erinnerte sich Albert Steinhauser, heute Nationalratsabgeordneter der Grünen, im Jahr 2013 an die Verhandlungen zurück (Albert Steinhauser: “10 Jahre Scheitern von schwarz-grün. Kein Grund für Wehmut“, 18. Februar 2013).


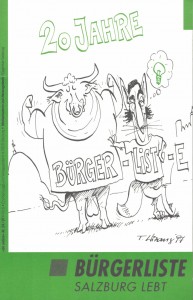
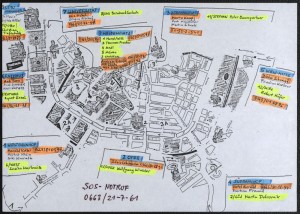
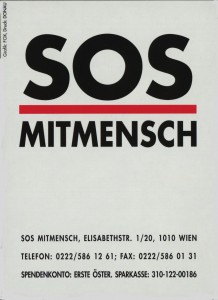
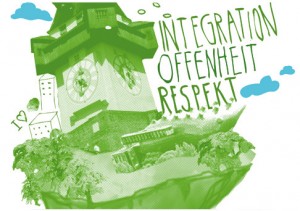



Neueste Kommentare